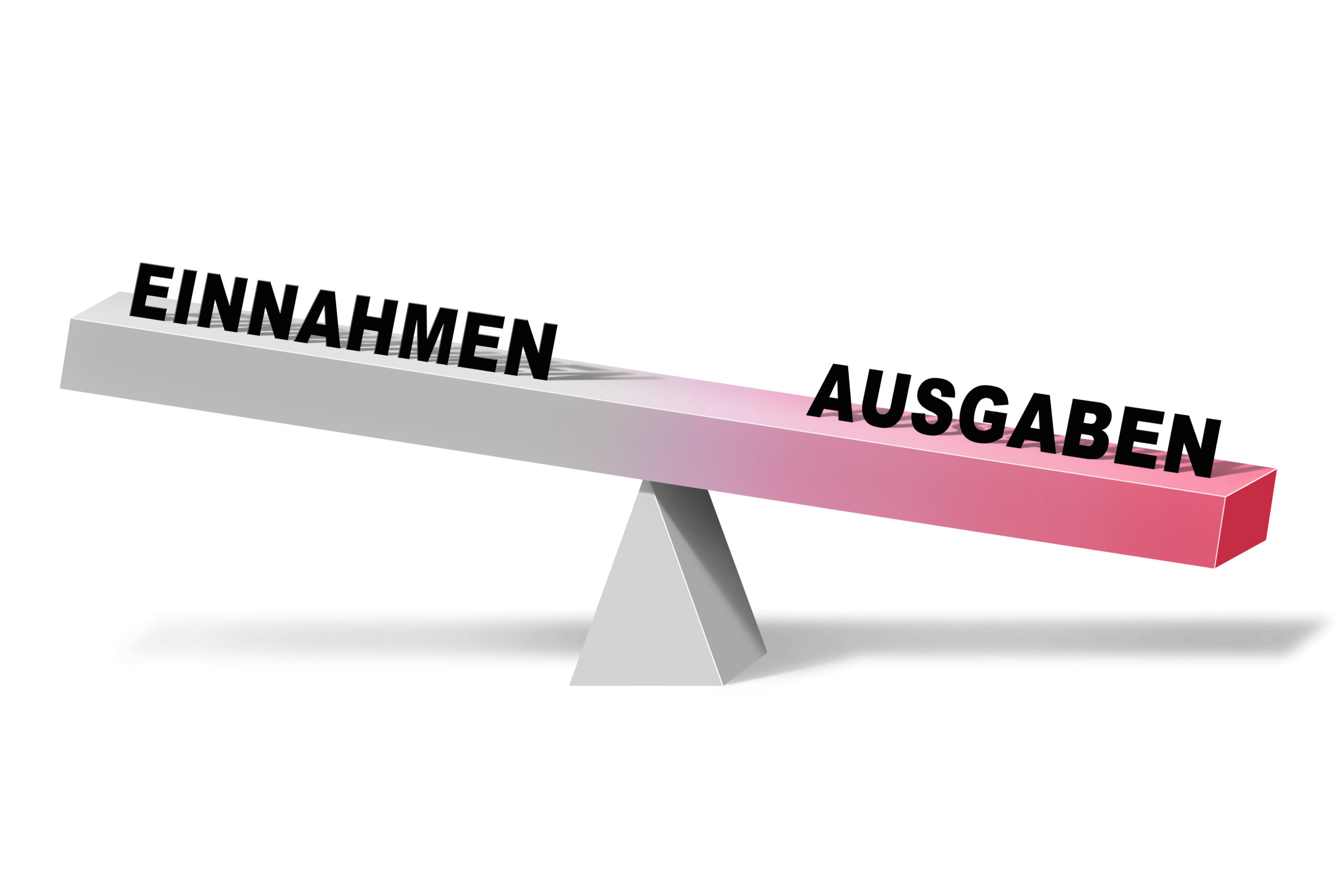Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) prognostiziert in ihrer aktuellen vierteljährlichen Finanzvorschau ein Bilanzdefizit von rund 900 Millionen Euro. Bei einem Gesamtbudget von 21 Milliarden Euro für das Jahr 2025 entspricht das einem Defizit von 4,29 Prozent. In einer Aussendung liefert die größte Krankenkasse Österreichs eine Begründung für die Schieflage.
Sinkendes Wirtschaftswachstum, eine immer älter werdende Bevölkerung, die Entlastung der Krankenhäuser… es gibt viele Gründe, die am Budget der Krankenkassen knabbern. Nachdem die ÖGK ihr Minus weiter nach unten korrigieren musste, liefert sie nun eine Erklärung, warum das System deratrig überstrapaziert ist:
Die ÖGK ist beitragsfinanziert: Die schwache Wirtschaftsentwicklung und die steigende Arbeitslosigkeit reduzieren die Beitragseinnahmen.
Demografie: Ältere Menschen gehen häufiger zum Arzt und sind öfter chronisch krank. Der demografische Wandel verschärft die Situation zusehends.
Rekordanstieg bei Arztbesuchen: Die ÖGK verzeichnet einen signifikanten Anstieg bei Arztbesuchen, zudem werden immer mehr medizinische Leistungen in Anspruch genommen und die Behandlungen sind kostenintensiver.
Weniger Beitragszahlungen: Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat das Wirtschaftswachstum für 2024 nach unten korrigiert, auf ein Minus von 0,9 Prozent. Für 2025 geht das WIFO von einem stagnierenden Wachstum aus. Die Rezession wirkt sich unmittelbar auf die Beschäftigung aus – ein entscheidender Faktor für die ÖGK, die als beitragsfinanzierte Sozialversicherung direkt davon abhängig ist.
PVE statt Klinik: Die gezielte Verlagerung von Leistungen aus dem Spitalsbereich in den niedergelassenen Bereich entlastet Krankenhäuser. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 24 neue Primärversorgungseinheiten (PVE) eröffnet, die Versicherten eine hochwertige Versorgung mit einem breiten Leistungsangebot zu erweiterten Öffnungszeiten bieten.
Mehr Arztbesuche: Immer mehr Menschen gehen immer häufiger zum Arzt/zur Ärztin.
Höhere Inanspruchnahme medizinischer Leistungen: Bei einem einzelnen Arztbesuch werden zunehmend mehrere Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt.
Zunahme kostenintensiver Behandlungen und Therapien: Der medizinische Fortschritt ermöglicht neue, aber oft teurere Behandlungsoptionen.
Mehr bildgebende Diagnostik: Während in Krankenhäusern um 17 Prozent weniger MR-Untersuchungen durchgeführt wurden, stieg die Anzahl dieser Untersuchungen bei niedergelassene Ärzten und Instituten in den vergangenen Jahren um 68 Prozent.
Neue, teure Medikamente: Etwa 0,8 Prozent aller Verordnungen verursachen rund 41 Prozent der Gesamtkosten; die teuersten fünf Medikamente machen fast 10 Prozent der Medikamentenkosten aus. Insgesamt sind die Kosten pro Verordnung in den vergangenen fünf Jahren um rund ein Drittel gestiegen.